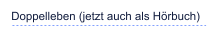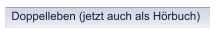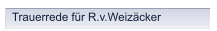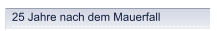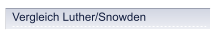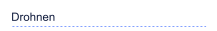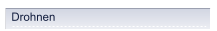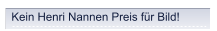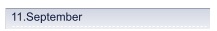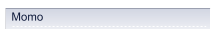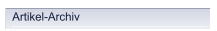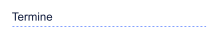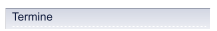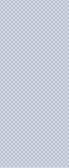
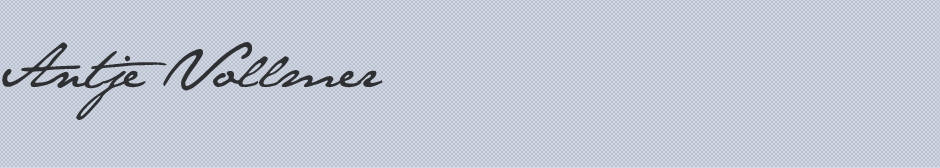





25 Jahre nach dem Mauerfall: Der Niedergang der
neokonservativen Strategien
Nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs begann eine neue Epoche westlicher Außenpolitik, die durch die neokonservative Strategie geprägt war. Viele der damals formulierten überschwänglichen Ziele und Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Stattdessen häufen sich Misserfolge, für die die Namen Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Georgien und seit kurzem auch Ukraine stehen. Wie ist es zu dieser Situation gekommen? Und gibt es überhaupt noch Alternativen zu einer geopolitischen Interessenpolitik, die offensichtlich so wenig erfolgreich ist ? Teil 1: Der Sieg im Kalten Krieg und seine strategischen Illusionen. Günstiger konnten die Bedingungen für den Westen gar nicht sein als zu Beginn der 90er Jahre: Der Warschauer Pakt war aufgelöst, die Sowjetunion war in einzelne Republiken zerfallen, China war noch kein ernstzunehmender Akteur auf der Weltbühne. Die langfristige Hegemonie des Westens über weite Teile der Welt, namentlich den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika, schien gesichert - nicht zuletzt durch seine durch die Zeitgeschichte „geadelte“ kulturelle und politische Ausstrahlungskraft. Die USA schienen sowohl die Macht als auch die Legitimität zu besitzen, die Weltordnung des 21. Jahrhunderts zu bestimmen - die Tragödie des 11. September 2001 fügte dem sogar noch die weltweite Empathie hinzu. Die westlichen Eliten machten sich daran, die Welt im Rahmen der Globalisierung und eines deregulierten Finanzmarktes für den ungehinderten Kapital- und Warenverkehr zu erobern. Einmal vom revolutionären Schwung dieser Erfolge ergriffen, grassierten damals völlig ahistorische Blütenträume: Nicht nur das Ende der Geschichte war angesagt, sondern auch die Unumkehrbarkeit der unipolaren Welt und der sie tragenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Warum, so wurde getagträumt, sollte nicht auch das Kunstgebilde Jugoslawien und gleich noch das große China mit seiner 5000 Jahre alten Kultur- und Herrschaftstradition nach dem Muster der Sowjetunion auseinanderbrechen? Die strategische Landkarte erschien vielversprechend: das erste, durchaus realistische Ziel der westlichen Außenpolitik war die Hegemonie über Osteuropa. Das zweite Ziel war die Neuordnung des Nahen Ostens mit den Mitteln des „regime-change“ in all den Nationen, die früher Verbündete der SU waren ( der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark nennt in einem Vortrag und Interview vom Jahr 2007ausdrücklich Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran). Das dritte Ziel war der Zugang und Zugriff auf die zentralasiatische Region, wo die kommende Konkurrenz zu China vermutet wurde und sich damit die Chance ergeben würde, Rußland und China auch von Land her einzukreisen. Auch dafür nahm der Iran eine Schlüsselstellung ein. Der entscheidende Wendepunkt dieser anfangs erfolgreichen Geo-Strategie war der im Frühjahr 2003 von den USA fast im Alleingang begonnene Irak- Krieg, der der Logik der Beistandserklärung der NATO von 2001 für den bis heute andauernden „Krieg gegen den Terror“ folgte. Als Ergebnis brachte dieser „Krieg gegen den Terror“ eine Destabilisierung des gesamten Machtgefüges im vorderasiatischen Raum, Kampf der schiitischen gegen die sunnitischen Regime, Auflösung von Staatlichkeit, Rückfall in alte Clan- Strukturen, anhaltende Bürgerkriege, anwachsender Drogenhandel, erneute Stärkung von Taliban und Al Qaida und wachsende Feindschaft der schutzlosen Bevölkerungen im zentralasiatischen Raum gegen die USA als Hauptakteur des Drohnenkrieges. Teil 2: Vision und Fehleinschätzung Michael Gorbatschows Michael Gorbatschow hat selten offen über seine höchstpersönliche Bilanz des großen Umbruchs gesprochen, für den sein Name wie kein anderer steht. Wer aber die Chance hatte, ihn einmal – 15 Jahre danach - zu diesem Thema in einer sehr kleinen Runde zu hören, wird niemals den Ausdruck tiefster Verbitterung vergessen, mit dem er am Ende feststellte: Nirgendwo im Westen habe es damals einen echten Partner für ihn gegeben; wahrscheinlich habe keiner im anderen Lager auch nur annähernd begriffen, welches Risiko er, der damals mächtigste Mann jenseits des Eisernen Vorhangs, mit dem politischen Konzept „Glasnost und Perestroika“ eingegangen sei; kein einziger Staatsmann im Westen habe verstanden, dass das von ihm angestrebte gemeinsame „Haus Europa“ auch eine tiefgreifende Erneuerung der westlichen Strukturen, Institutionen und Denkweisen erfordert hätte, um eine völlig neue einmalige Zukunftsperspektive für den ganzen Kontinent zu eröffnen. Im gesamten westlichen Staatensystem, so müsse er rückblickend feststellen, habe nur ein Triumphalismus ohnegleichen und reine Siegermentalität geherrscht. Das sei am Ende der Grund gewesen, warum Russland, nach dem politischen Ausverkauf und der ökonomisch-politischen Anarchie der Jelzin-Jahre einen Machtmenschen wie Wladimir Putin geradezu gebraucht hätte, wollte es nicht gänzlich aus der Weltpolitik verschwinden. Tatsächlich ist es immer noch sinnvoll, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was Gorbatschow damals als politisches Konzept angestrebt hat. In nüchterner Einschätzung, dass weder das sowjetische Wirtschaftssystem, noch der aufgeblasene Militärapparat und schon gar nicht die innere Verfasstheit der sozialistischen Gesellschaften die Systemauseinandersetzung zwischen Ost und West gewinnen konnten, wollte er zwar auch sein eigenes Land retten, aber vor allem den Kalten Krieg zu Ende bringen – und damit zugleich die letzten Verwerfungen der beiden großen Weltkriege beseitigen. Wenn etwas bei Gorbatschow durchgängig stringent ist, dann seine Bereitschaft, Kriege und Kriegsbereitschaft zu beenden: Er ordnete den Rückzug aus Afghanistan an, er hob die Breshnew-Doktrin auf und erlöste die Verbündeten vom Zwangssystem des Warschauer Paktes, er bot den USA die völlige gegenseitige nukleare Entwaffnung bis zur Jahrtausendwende an, er reduzierte die eigenen Streitkräfte auf 500 000 Mann, er leitete eine Entspannungspolitik gegenüber China ein. Er ging dabei von der unter Realpolitikern äußerst selten anzutreffenden, letztlich idealistischen Annahme aus, eine freiwillige Machtaufgabe könne auch auf der Gegenseite ungeahnte Wirkungen entfalten. Er vermutete, dass die Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu einer völlig neuen multipolaren Weltordnung bereit sei und dass diese eine große Zukunft haben könne, wenn sie nicht so gewaltgeboren und gewaltgeprägt wäre wie die Nachkriegsordnungen des Versailler Vertrages von 1918 und des Systems von Jalta nach 1945. Dass es um eine echte selbstbestimmte Machtaufgabe ging, beweist allein schon die weitgehende Gewaltfreiheit der Umstürze in so vielen einzelnen Ländern von 1989 an, die fast ohne Verlust von Menschenleben vollzogen wurden. Wer diese Tatsache bestreitet, fällt seiner eigenen Propaganda anheim, die behauptet, die sowjetischen Armeen und Funktionseliten seien schon so marode und ohnmächtig gewesen, dass die NATO-Nachrüstung, ein kesser Spruch von Ronald Reagan („Mister Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein“), ein deftiger Anrempler von Helmut Kohl (Vergleich Gorbatschows mit Goebbels), Friedensgebete, Kerzen, Transparente und Versammlungen auf den Straßen ein Weltreich dieser Größe allein in die Knie gezwungen hätten. Nein, über die Gewaltfreiheit dieses Umsturzes wurde letztlich nicht im Westen entschieden, sondern im Machtzentrum des Kreml. Das genau hat Gorbatschow in der Rückschau in seinem eigenen Land so unbeliebt gemacht und ihm den Ruf eingetragen, er habe 1989, als er das Militär in den Kasernen ließ und auf positive Reaktionen im Westen hoffte, nicht nur den Kalten Krieg, sondern gleich auch noch die beiden Weltkriege nachträglich für Russland verloren. Immerhin bezahlte er diese gewaltarme Strategie nicht nur mit dem historisch überfälligen Auseinanderbrechen der Sowjetunion und Rußlands Absturz in die zeitweise Bedeutungslosigkeit, sondern auch mit der Tatsache, dass eine erweiterte und verstärkte NATO heute direkt an den Grenzen Russlands steht. Dass dies ein offensichtlicher Wortbruch gegenüber den diplomatischen Versprechungen aus den 2 plus 4 -Verhandlungen ist, wird auf Nachfrage gern so begründet: Diese Zusage habe man doch der Sowjetunion gegeben, die ja bekanntlich nicht mehr existiere! So zeigt sich drastisch, dass der Westen nach 1990 längst die eigene so erfolgreiche Strategie der Entspannung, der vertrauensbildenden Maßnahmen, der gemeinsamen Sicherheit, der KSZE und der Deeskalation zwischen den Blocksystemen verlassen hatte, auf deren Verlässlichkeit Gorbatschow noch vertraute – und ohne die er vermutlich nie in seine zentrale Position gekommen wäre. Tatsächlich ist erst heute sichtbar, dass in diesem einseitigen Prozess des Pokerns und Übervorteilens, der sich Realpolitik nennt, auch der Westen langfristig eine der chancenreichsten Wegkreuzungen zu einer neuen anderen Nachkriegsordnung mutwillig verspielt hat, die zu einer krisenfesteren und friedlicheren Staatengemeinschaft des 21.Jahrhunderts hätte führen können. Das wurde relativ früh sichtbar, als in den Jugoslawienkriegen jede diplomatische Vermittlung von russischer Seite abgewiesen wurde – im Bewusstsein des erwarteten schnellen Sieges, der historischen Vorteile der eigenen Position und der weitgehenden Akzeptanz des beginnenden Menschenrechts-Bellizismus in den westlichen Medien bis hinein ins sozialdemokratische und grün-alternative Spektrum. Erst weitere 15 Jahre später, nach opferreichen Kriegen und Irrwegen kommt man in der Syrien-, Libanon- und Iran-Diplomatie langsam wieder auf diese Reste einer Strategie der Entspannung, der gemeinsamen Sicherheit und der diplomatischen Lösungen zurück. Teil 3: Das Zerschellen einiger westlicher Illusionen an der realen Welt. Was machte die westlichen Staaten eigentlich 1990 so sicher, auf der historischen Siegerstraße nur voranschreiten zu müssen? Fatalerweise war es vermutlich gerade die Leichtigkeit, mit der das sowjetische Blocksystem zusammenbrach, die der realpolitischen Schule und den geopolitischen Strategen in Washington, London und Bonn damals nahe legten, jetzt könne man die Landkarte Europas und dazu gleich noch das bestehende Völkerrecht in Windeseile verändern und damit ohne nennenswerte eigene Opfer Geschichte schreiben. Die Situation lud zu Umbrüchen ein, die Legende von der friedlichen demokratischen Revolution überzeugte Massen und Medien – der Mythos von dem „Fenster der einmaligen Gelegenheit“, das nur beherzt von tatkräftigen Staatsmännern aufgestoßen werden müsse, schien überzeugend und befreite von unnötigen Grübeleien. Hinzu kam, dass die schnelle Osterweiterung von NATO und EU von den betreffenden Nationen selbst mit Entschiedenheit gefordert wurde. Die Angebote der neoliberalen und auf Globalisierung ausgerichteten Wirtschaftsschule der Neokonservativen versprachen den schnellstmöglichen Anschluss an westlichen Wohlstand und den größtmöglichen Abstand zur untergegangenen Sowjetwelt. Für die begabten jungen Eliten dieser Länder – die meisten kamen aus den staatlich organisierten Jugendorganisationen, zu denen ein Michail Chodorkowski genau so gehörte wie Julia Timoschenko oder Angela Merkel – wurde dieses Versprechen auch glanzvoll erfüllt und machte sie zu besonders gelehrigen Musterschülern und Propagandisten der herrschenden Wende-Ideologien. Die praktischen Folgen der radikalen Umstellungsmaßnahmen in den meisten Ländern ernüchtern heute allerdings und zeigen auch die Verlierer der Wende: Massenarbeitslosigkeit, Korruption, Nationalchauvinismus und Fremdenphobien, sinkende Lebenserwartung und ständige Abwanderung qualifizierter Fachkräfte prägen viele postsozialistischen Staaten. Die Umstellung auf die neuen Systeme war oft, dank der „Hilfe“ von westlichen Beratern, stur nach Lehrbuch erfolgt. Vergessen wurde bei diesem triumphalen Aktivisten-Rausch, der dem Ende des Kalten Krieg folgte, die wichtigste Lehre aus den beiden Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts: Dass der Krieg nicht gewonnen ist, wenn es nicht gelingt, eine Friedensordnung zu installieren, die auch den Besiegten einschließt. Das ungerechte System von Versailles, das den jahrhundertealten Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn ersatzlos von der europäischen Landkarte gestrichen hatte und in vielen Details ebenfalls vom idealistisch- revolutionärem Elan eines Wilson geprägt war, hatte eine Welt voller unklarer Staatengebilde und national-chauvinistischer und rassistischer Ressentiments hinterlassen, die bereits den Keim zu neuem Unheil in sich bargen. Ebenso droht heute der zweite Kalte Krieg dem ersten zu folgen. Es scheint nur noch nicht ausgemacht, ob er gegen China oder gegen die islamische Welt – oder vielleicht sogar gegen beide – geführt werden soll. Teil 4: Gibt es noch ein Rückkehr zur Diplomatie, zur Entspannungspolitik und zum Völkerrecht? Es ist Zeit, innezuhalten und nachzudenken! Inzwischen ist klar, trotz Tibet und Tiananmen: China wird nicht den Weg der Sowjetunion gehen, so sehr sich das manche Menschenrechts-Bellizisten auch wünschen mögen. Putins Russland wird nicht an Pussy Riot-Aktivistinnen und noch nicht einmal an der Unterstützung für Michail Chodorkowski zugrunde gehen. Die militanten und oft im Ton äußerst aggressiven medialen Lifestyle-Kampagnen – Mohammed- Karikaturen, Freiheit für Google und Starbucks, Olympia-Boykott für den Dalai Lama – haben ihren Zenit überschritten. Sie waren Teil einer leichtfertigen kulturellen Trunkenheit, der politische Alltag kehrt zurück. Vor allem: Der Nahe Osten, wo einmal alle Konflikte begannen und alle Großmacht-Interessen aufeinanderprallten, ist nicht befriedet, sondern in hohem Maße destabilisiert. Das Gleiche gilt für den Kaukasischen Raum, das „Herzland“ des eurasischen Megakontinents. Die Schlüsselkriege, die in beiden Regionen revolutionäre Umbrüche erzeugen sollten, sind genau so gescheitert wie der Vietnam-Krieg aus jener Zeit, als der Kalte Krieg anderswo auch heiß war. Gescheitert ist damit noch einmal die diesmal umgekehrte Domino-Theorie: Gelänge es, in einem Staat dieser Region den angestrebten „regime-change“ von außen zu bewirken – und sei es unter dem Vorwand der „responsibility to protect“ – so würden die anderen zwangsläufig folgen. Dass dieses Scheitern so lange so wenig ins Bewusstsein der westlichen Öffentlichkeit drang, lag an der erheblich verbesserten „eingebetteten“ medialen Kriegspropaganda und der gelungenen moralischen Aufrüstung für die Vollendung einer „Mission“ der demokratischen Rettung der ganzen Welt. Aber auch hier beginnt Ernüchterung um sich zu greifen: Am Hindukusch wurde nicht unsere Freiheit verteidigt, sondern die sinnlose Illusion einer monokulturellen Weltordnung. Es gab einmal andere Politik-Methoden, in jener Zeit, als die Welt noch nahe am Abgrund eines nuklearen Weltkrieges stand und unter der Knute rassistischer Diktaturen litt. Willy Brandt und Egon Bahr entwickelten sie gegenüber der (nicht-reformierten) SU, Henry Kissinger und Richard Nixon gegenüber der (maoistischen) VR China, Nelson Mandela innerhalb des Apartheid-Regimes Südafrika. Es war eine Politik des Dialogs ohne Vorbedingungen, die auf Entspannung, Wandel durch Annäherung, Offenheit für innere Reformen, Versöhnungsbereitschaft mit den Eliten der gegnerischen Seite und das Bewusstsein einer gemeinsamen Welt- Verantwortung setzten, nicht auf den Sieg des Stärkeren oder auf die Demütigung des Besiegten. Aus dieser Politik ist der KSZE-Prozess entstanden, eine Stärkung der UNO, eine Überwindung der Blockkonfrontation, eine Politik der vertrauensschaffenden Maßnahmen und gemeinsamer Sicherheitspartnerschaften. Wenn alle neokonservativen Illusionen und Weltherrschaftsträume verflogen sind, bleibt uns hoffentlich noch Zeit genug , dahin zurückzukehren. Antje Vollmer Hauke Ritz 23.Januar 2014 > Zurück
© 2014 Dr. Antje
Vollmer